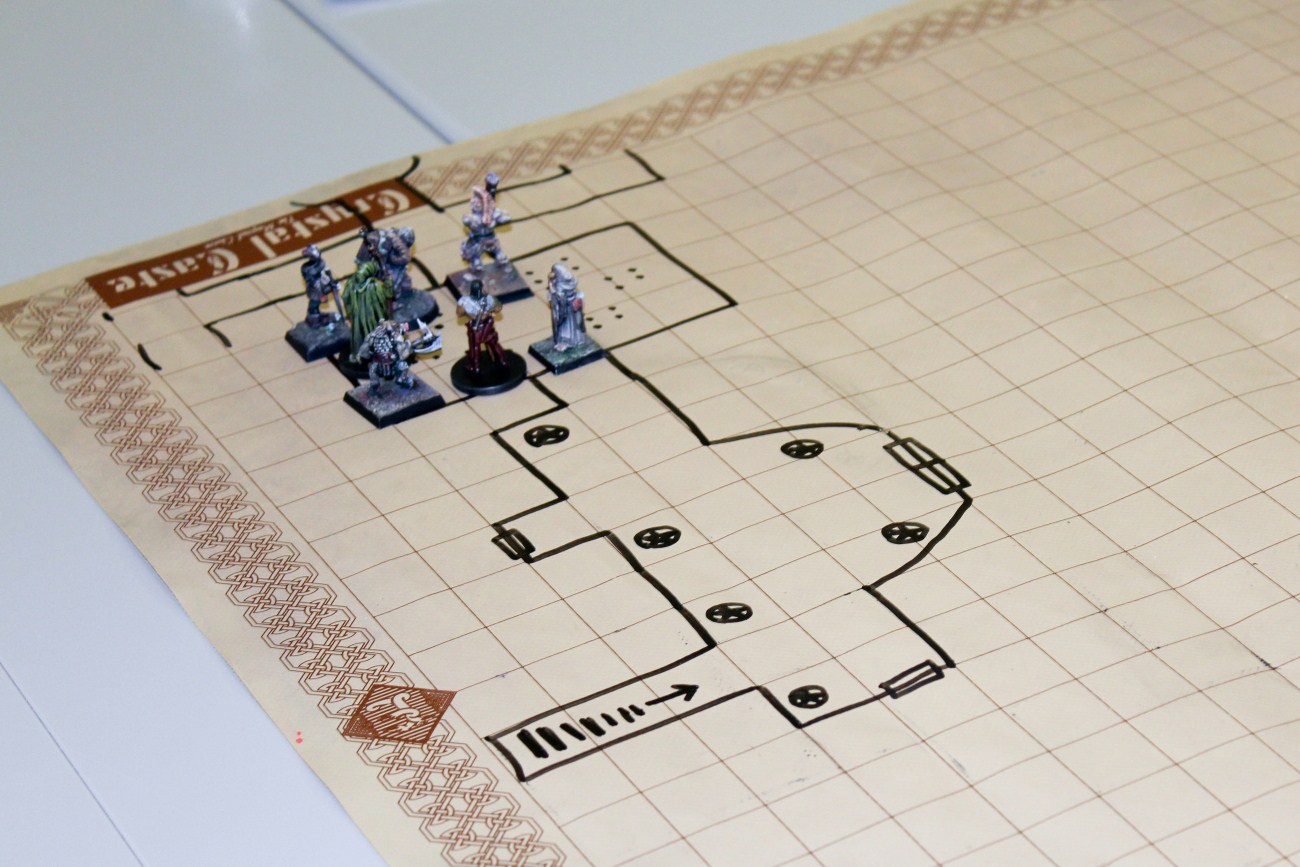Der Karneval der Rollenspielblogs hat im Juli zu Beiträgen für das Thema „Engel und Dämonen“ aufgerufen. Die Moderation liegt bei Neue Abenteuer, alle Beiträge des Monats werden zudem in diesem Thread des Forums der Rollenspielblogs aufgelistet.
Klaus Westerhoff wollte dazu am liebsten etwas zu In Nomine in der Fassung von Steve Jackson Games schreiben. Da das Rollenspiel aber inzwischen fast zwanzig Jahre auf dem Buckel hat, nur noch als pdf erhältlich ist und zumeist weniger beliebt ist als das französische Original hat er sich aus einer Laune heraus dazu entschieden, dieses Setting für Fate Core umzusetzen.
Wir wollen natürlich auf diese Arbeit hinweisen und diese ebenfalls zum Download anbieten.
Der Kampf um die Seelen der Menschen tobt seit dem Fall Luzifers und der Erschaffung der Hölle. Während die Engel den Sterblichen helfen, ihre wahre Bestimmung zu erfüllen, locken Dämonen sie mit Wollust, Völlerei und dem inhaltsleeren Geschwätz der Massenmedien.
In dieser Konvertierung des Rollenspiels In Nomine von Steve Jackson Games zu Fate Core übernimmst Du selbst die Rolle eines Engels oder Dämons in diesem ewigen Konflikt.
[wpfilebase tag=file id=37 /]
Wie und Warum er das gemacht hat beschreibt Klaus im dazugehörigen Blogbeitrag, hier zusätzlich wiedergegeben:
Warum In Nomine? Warum Fate?
Der Kampf um die Seelen der Menschen ist so alt wie die Menschheit selbst und im Rollenspiel nicht neu. Während wie schon erwähnt viele deutsche Blogger und Forumsbeitragende den sehr schwarzen Humor des französischen Fassung, verfasst von Croc und zeitweilig auch von Truant in deutsch erhältlich, schätze ich an der amerikanischen Fassung, dass es dieses eigentlich recht heikle Thema mit dem nötigen Respekt angeht, der vom Genre verschiedene Interpretationen zulässt. Zumindest im Webshop von Steve Jackson Games, dem Warehouse 23, ist das gesamte System noch als pdf erhältlich.
Eines der Kernelemente des Settings sind dabei Worte – generelle Konzepte, Objekte oder abstrakte Gedanken in der Schöpfung, um deren himmlische oder infernale Auslegung Engel und Dämonen im Wettstreit liegen. So haben beide Seiten einen Erzengel beziehungsweise einen Prinzen des Krieges, der Erzengel des Blitzes steht im Zwist mit dem Prinzen der Technologie, oder der Erzengel der Bestimmung sieht das höchste Potential eines Sterblichen, während der Prinz des Schicksals nur dessen tiefste Abgründe fördert. Diese abstrakten Begriffe sind aber eben auch genau das, was im Zentrum von Fate steht: Aspekte. Sieht ein Spieler, wie eine Situation in direktem Zusammenhang mit seinem Wort steht, so kann er dies mit einer kurzen Erklärung in einen spielrelevanten Bonus umsetzen, ohne dass komplexe Regeln dafür nötig währen. Deshalb also: Fate In Nomine.
Nach dieser Entscheidung gilt es aber auch, die größte Hürde einer jeden Konvertierung zu nehmen: Convert the setting, not the rules – und das hat mir an einigen Stellen verdammtes Kopfzerbrechen bereitet.
Drei Sphären der Schöpfung
Neben der übergreifenden Bedeutung von Worten fasziniert mich noch ein anderes Element des Settings von In Nomine (SJG): Die drei Sphären der Schöpfung. So macht das System deutlich, dass es die physische Welt der Sterblichen, die geistige der Träume und die seelische von Himmel und Hölle gibt. Diese Dreiteilung zieht sich bei Steve Jackson Games durch sämtliche Mechanismen: So werden drei Duos von Attributen unterschieden, Vergehen gegen die eigene Natur (dazu unten mehr) können sich in einer der drei Formen manifestieren, und Lieder (vulgo: Zaubersprüche) vermögen drei Effekte je gewirkter Sphäre zu haben.
Um diese in Fate abzubilden, verfügen Charaktere in Fate In Nomine über einen dritten Stressbalken für seelischen Schaden, der an das Attribut Empathie für Zusatzkästchen gebunden ist. Die Umsetzung der Lieder hingegen hat mich Nerven gekostet – so bietet gerade das Fate System Toolkit diverse Ansätze, Magie in Fate abzubilden, insgesamt erweist sich aber das Grundgerüst von Fate dabei als ähnlich schwammig, als wolle man mit gekochten Nudelblättern für Lasagne ein Kartenhaus bauen wollen.
Ursprünglich hatte ich vor, jeden Spruch eben wegen der drei Effekte als eigens zu erlernende Fertigkeit abzubilden, ähnlich dem Original, wo alle Sprüche in ihren Manifestationen einzeln gelern werden müssen. Einen separaten Aspekt, um dies zu erlauben, finde ich in dem Setting nicht gerechtfertigt: So heisst es doch, Lieder seien eine verbreitete Fähigkeit unter Engeln und Dämonen.
Spätestens bei der Beschreibung der Effekte zeigte sich aber der Makel dieses Ansatzes: Die Beschreibung der allgemeinen Fertigkeit Lieder hätte nur sehr schwammig die Optionen für die vier Aktionen beschrieben, und genauso hätten die einzelnen Lieder sehr viele Redundanzen dieser Beschreibungen oder zu oft den lapidaren Hinweis enthalten, diese oder jede Aktion sei hier nicht möglich.
So bleibt es letztlich bei der generellen Fertigkeit Lieder, für die jede Effektsammlung ein einzelner Stunt ist, was die mechanische Umsetzung stark entschlackt. Da aber eben jeder Stunt auch drei verschiedene Effekte beinhaltet, musste ein Limit für diese Fülle an Anwendungsmöglichkeiten her. Diese wie auch die Stressbalken an die Fertigkeiten Kraft, Wille und Empathie zu knüpfen lag auf der Hand. Meine erste Lösung, die Stufe der jeweiligen Fertigkeit als jeweils maximale Stufe für die Fertigkeit Lieder je nach Anwendungsart zu nutzen, musste aber scheitern, da einige Stunts, andere Fertigkeiten durch Lieder zu ersetzen. So geben die drei Fertigkeiten Kraft, Wille und Empathie nun die maximale Anzahl an, den körperlichen, ätherischen oder celestischen („celestial“ ist wirklich nicht gut zu übersetzen…) pro Szene einzusetzen, was vor allem während Konflikten interessant sein dürfte.
Gegen die eigene Natur
Ein weiteres Kernelement der englischen Vorlage ist die sogenannte Resonanz. Die Schöpfung ist eine Symphonie, aus der jeder Engel und Dämon den Aspekt heraushört, der seiner Natur entspricht. Dies kann bei Seraphim etwa die Wahrheit sein, bei Cherubim Schutz oder bei Malakim Tugend sein, bei ihren infernalen Gegenstücken den Balseraphim Lüge, den Djinni Gleichgültigkeit oder den Calabim Zerstörung. Auch hierfür habe ich eine neue Fertigkeit eingeführt, die ebenfalls auf den Namen Resonanz hört. Im allgemeinen macht diese nicht viel, aber individuelle Stunts der Engel und Dämonen ermöglichen, eben genau die Elemente gemäß der eigenen Natur aus der Symphonie herauszuhören.
Genauso kann es aber eben auch sein, dass ein Engel oder Dämon wider seine Natur handelt, ein Seraph also etwa lügt oder ein Cherub nicht sein Mündel erfolgreich beschützt. Dies ist nicht zu verwechseln mit dem Dilemma – dieses entspricht ja der eigenen Natur, obwohl es einen Charakter dadurch in Schwierigkeiten bringt. Gegen die eigene Natur zu handeln sorgt stattdessen für einen Missklang in der eigenen Symphonie eines Engels oder Dämons, für Dissonanz. Diese ist als ein vierter Stressbalken dargestellt, deren Konsequenzen schließlich die innere Zerrissenheit eines Charakters sich – analog zu den drei Sphären der Schöpfung – körperlich, geistig oder seelisch manifestieren können. Dementsprechend sind Dissonanz und Diskord nur sehr schwer zu entfernen und verlangen meist den Einsatz des eigenen Vorgesetzten. Sammelt man schließlich zu viele Konsequenzen in Form von Diskord an, wechselt man auf die Gegenseite – ein Engel fällt und wird zum Dämon, ein Dämon wird geläutert und wird zum Engel.
Stunts, so viele Stunts
Das Grundregelwerk des englischen In Nomine listet neben der Beschreibungen der himmlischen und infernalen Vorgesetzten etliche Spieleffekte auf, die ihre Diener erwerben können. Da diese in meinen Augen auch sehr viel von dem Spielgefühl vermitteln, den der Dienst für einen bestimmten Erzengel oder Dämon mit sich bringt, habe ich diese Effekte in einzelne Stunts übersetzt. Die Auswahl erscheint so zwar riesig, aber natürlich kann ein Charakter nur die Stunts erwerben, die zum eigenen Vorgesetzten gehören.
Bei der Konvertierung in Stunts war unübersehbar, dass das Spielniveau der einzelnen Effekte sehr breit gestreut ist von netten Wahrnehmungsfähigkeiten bis hin zu sehr mächtigen Effekten in Konflikten. Schlecht balanciert? Wahrscheinlich, aber ich halte es durchaus für angemessen, wenn ein Engel des Schwerts oder Dämon des Kriegs nun einmal besser austeilen kann als ein Engel der Blumen oder ein Dämon der Völlerei.



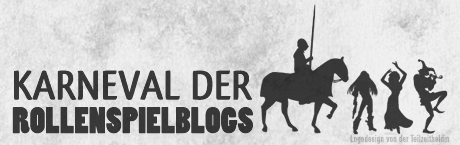


 Dank
Dank